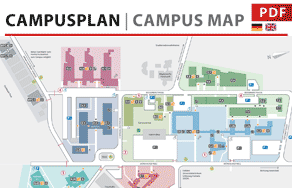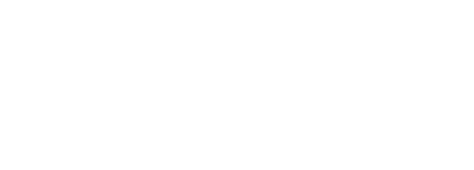Labor für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik
Das Labor für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik bearbeitet Projekte aus allen Bereichen der Siedlungswasserwirtschaft, insbesondere in den Bereichen der Abwasserbehandlung, Regenwasser-Bewirtschaftung und Ressourcenrückgewinnung.
- Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein (MaReT-SH)
Projektleitung
Prof. Dr.-Ing. Matthias Grottker (i.R.) Projektbearbeitung
Laufzeit: 2023-2025
Förderung: Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN SH)
Projektpartner:
Projektbeschreibung:
Das Forschungsvorhaben MaReT-SH (Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein) wurde von der Technischen Hochschule Lübeck in Kooperation mit der Limbach Analytics GmbH im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Schleswig-Holstein durchgeführt. Ziel war die Untersuchung der Stoffrückhaltefähigkeit von Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD), die in Schleswig-Holstein weit verbreitet sind, jedoch in der bundesweiten Regelung DWA-A 102 nicht empfohlen werden. Ergänzend wurde ein Mulden-Rigolen-System als dezentrale Maßnahme untersucht.
Es wurden fünf RKBmD unterschiedlicher Größe, hydraulischer Belastung und Einzugsgebiete untersucht. Die ereignisbezogenen Probenahmen umfassten Zulauf, Ablauf und Sedimente. Analysiert wurden hydraulische Parameter (Durchfluss, Trübung), Schwebstoffe (AFSgesamt, AFS63), Schwermetalle (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK16) sowie organische Spurenstoffe (z. B. 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Glyphosat, Pflanzenschutzmittel). Die Analysen erfolgten mittels ICP-OES, GC-MS/MS und HPLC. Auf Grundlage der Messungen wurden Stofffrachten und Wirkungsgrade berechnet und mit den Umweltqualitätsnormen (UQN) abgeglichen.
Die Ergebnisse zeigen, dass RKBmD einen erheblichen Rückhalt fein suspendierter Stoffe und daran gebundener Schadstoffe leisten können. Die Wirkungsgrade für AFS63 lagen zwischen 30 und 80 %, abhängig von der hydraulischen Belastung und dem Dauerstauvolumen. Sedimentuntersuchungen belegten eine deutliche Anreicherung von Schwermetallen und PAK, während Eluatuntersuchungen ein Risiko der Remobilisierung aufzeigten. Schwermetalle und PAK wurden zwar deutlich reduziert, jedoch wurden UQN-Überschreitungen im Zulauf regelmäßig festgestellt und teils bis in den Ablauf übertragen. Organische Spurenstoffe zeigten eine hohe Variabilität und nur teilweise Rückhalte. Starke Korrelationen zwischen AFS63, Trübung und partikelgebundenen Schadstoffen wurden nachgewiesen, während gelöste Stoffe keine oder nur schwache Korrelationen zeigten.
Die Untersuchung verdeutlicht, dass RKBmD – entgegen den aktuellen Empfehlungen – bei sachgerechter Bemessung, Wartung, Entschlammung und Unterhaltung wirksam zum Stoffrückhalt beitragen können. Fehlende Entschlammung mindert die Leistungsfähigkeit erheblich, und organische Spurenstoffe werden weiterhin unzureichend behandelt. Eine rein hydraulische Bemessung ist unzureichend; stoffliche Kriterien müssen integriert werden.
Empfehlungen umfassen die Definition von Durchgangswerten für AFS63 auf Basis des spezifischen Stauvolumens und der Oberflächenbeschickung, die Sicherstellung regelmäßiger Entschlammung, die Erweiterung des Monitorings um organische Spurenstoffe sowie eine stärkere Berücksichtigung von Mulden-Rigolen-Systemen in der Planung. Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich der Entfernung gelöster Schadstoffe und des Einflusses von Unterhaltungsmaßnahmen auf die langfristige Leistungsfähigkeit.
Zusammenfassend können RKBmD und Mulden-Rigolen-Systeme zentrale Bausteine einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in Schleswig-Holstein darstellen. Ihre fachgerechte Auslegung und der Fokus auf stoffliche Aspekte bilden eine wichtige Grundlage für den zukünftigen Rechtsrahmen (A-RW 2) und die Sicherung der Gewässerqualität.
- Emission von Spurenstoff-Frachten und multiresistenten Keimen über den Klärschlammpfad in Schleswig-Holstein (EKlä-SH)
Projektleitung
Projektbearbeitung
Laufzeit: 2023-2025
Förderung: Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN SH)
Projektpartner:
- Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Arbeitsbereich Krankenhaushygiene (Prof. Dr. Johannes Knobloch, Dr. Laura Carlsen)
- Limbach Analytics GmbH, Chemisches Laboratorium Lübeck
Projektbeschreibung:
Die stoffliche Verwertung von Klärschlamm stellt eine kostengünstige Alternative zu anderen Entsorgungswegen dar. Zugleich eignen sich die im Klärschlamm enthaltenden Nährstoffe als Pflanzendünger. In Schleswig-Holstein fällt jährlich Klärs¬chlamm mit einer Trockenmasse von etwa 71.000 t TM an. Etwa 20 bis 55 % davon werden stofflich verwertet; der übrige Anteil wird thermisch bisher i.d.R. in Co-Verbrennungsanlagen verwertet . Es ist vermutlich dem hohen Anteil landwirtschaftlicher Flächen geschuldet, dass Schleswig-Holstein von allen Bundesländern einer der höchsten Quoten für die landwirtschaftliche Verwertung aufweist. Der Generalplan Abwasser und Gewässerschutz (Schleswig-Holstein, 2021) geht davon aus, dass aufgrund der „guten Qualität“ eine landwirtschaftliche Verwertung auch nach den Vorgaben der im Jahr 2017 novellierten Klärschlammverordnung (AbfKlärV) weiterhin möglich sei. Da es sich für kleinere Anlagen anböte, Kooperationen mit größeren Anlagen hinsichtlich der Behandlung und Entsorgung von Klärschlamm einzugehen und damit aufgrund der in der AbfKlärV verankerten Schwellenwerte (ab 2029: > 100.000 EW und ab 2032: > 50.000 EW) eine landwirtschaftliche Verwertung ausgeschlossen wäre, würde diese künftig eine untergeordnete Rolle spielen. Bisher lässt sich eine solche Entwicklung nicht erkennen.
Ferner wurde im Arbeitsprogramm des Generalplan Abwasser und Gewässerschutz festgeschrieben, dass Klärschlamm auf die Belastung mit Keimen und Spurenstoffen und damit eine mögliche Belastung der landwirtschaftlichen Fläche durch Klärschlammaufbringung wissenschaftlich untersucht werden soll. Die Planung und Durchführung von Untersuchungen, die Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen sollen in den Jahren 2023-2025 im Rahmen eines Projektes durchgeführt werden. Hierzu gehörte vor allem auch eine Recherche vor Beginn der Untersuchungen, welche Erkenntnisse bereits in Deutschland zu den genannten Themen vorliegen und welche Stoffe in Bezug auf den Klärschlamm sowie für die Aufnahme durch Pflanzen oder aber Adsorptionsprozesse im Boden relevant sind. In Schleswig-Holstein wurde bspw. in 2007 ein Klärschlammunter-suchungsprogramm durchgeführt, das bei der Aufstellung des Untersuchungsprogramms berücksichtigt wurde.
Zum Untersuchungsinhalt gehören entsprechend die Erfassung der Spurenstoff-Frachten sowie die Feststellung und Quantifizierung von multiresistenten Keimen im Klärschlamm in ausgewählten Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von bis zu 50.000 EW (bis GK 4a) in Schleswig-Holstein. Größere Kläranlagen müssen ihren Klärschlamm ab 2029 stufenweise der Verbrennung zuführen. Für die kleineren Kläranlagen ist mittelfristig weiterhin die landwirtschaftliche Ausbringung des Klärschlamms vorgesehen.
Im Rahmen des Projektes sollen Kennwerte für die auf diesem Pfad emittierten Spurenstoff-Frachten erhoben werden. Ferner soll untersucht werden, inwieweit eine Emission von multiresistenten Keimen vorliegt. Hierfür ist ein Monitoring-Programm vorgesehen, in dem verschiedene Kläranlagen in Schleswig-Holstein berücksichtigt werden. Neben der Erfassung vorgenannter Emissionen, spielt auch die Betrachtung möglicher Wechselwirkungen zwischen beiden Verschmutzungsarten eine zentrale Rolle.
- Erweiterung der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) Reinfeld mit Modulen einer sog. 4. Reinigungsstufe (4RS-VAK )
Projektleitung
Projektbearbeitung
Laufzeit: 2022-2025
Förderung: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) auf Iniative des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN SH)
Projektbeschreibung:
Die bisher auf der Versuchs-und Ausbildungskläranlagen (VAK) der TH Lübeck vorhandene Anlagentechnik (Belebtschlammverfahren) entspricht dem Stand der Technik der 1990er Jahre. Sie erlaubt vorrangig die Minimierung des Nährstoffgehaltes zum Schutz der Gewässer gegenüber einer Eutrophierung oder einem akuten Sauerstoffdefizit. Seit der Inbetriebnahme wurden in der Fachwelt zunehmend weitergehende Probleme hinsichtlich des Umgangs mit Abwasser und der notwendigen Reinigungsleistung identifiziert. Hierzu zählen insbesondere folgende Themenfelder:
- Die Notwendigkeit einer energieeffizienten und damit möglichst klimaneutralen Abwasserreinigung.
- Der Rückhalt von anthropogenen Spurenstoffen (u.a. Arzneistoffen), die bisher nicht vollständig in der kommunalen Abwasserreinigung zurückgehalten werden und die nachweislich zu einer negativen Beeinflussung der Ökosysteme in den Gewässern führen können.
- Rückhalt von Mikroplastik, das als Quellen von Weichmachern oder als Träger weiterer Spurenstoffe problematisch für die aquatische Umwelt g sein können.
- Rückhalt von (multiresistenten) Keimen, für die keine oder nur noch wenige Antibiotika zur Verfügung stehen und die aktuell zu gewissen Anteilen durch Kläranlagen in die Gewässer eingetragen werden.
Um diese Themenfelder zu adressieren und die VAK dem Stand der Forschung entsprechend auszustatten, wird das Vorhaben durchgeführt. Das Vorhaben hat somit zum Ziel, verschiedene Module einer sog. 4. Reinigungsstufe im halbtechnischen Maßstab als Pilotanlagen zu beschaffen, diese in Betrieb zu nehmen und für den testweisen Einsatz auf verschiedenen kommunalen Kläranlagen im Land SH sowie Untersuchungsprogramme in der VAK selbst vorzubereiten. Für den testweisen Einsatz kommen prinzipiell alle Kläranlagen in Schleswig-Holstein in Betracht. Neben dem Testbetrieb auf größeren Kläranlagen (GK 3-5) soll ebenfalls eine Untersuchung von Verfahrensvarianten möglich sein, die auch eine Aufrüstung kleiner Kläranlagen (GK 1 und 2, z.B. Teichkläranlagen) hinsichtlich eines verbesserten Spurenstoff-Rückhaltes ermöglichen.
Mithilfe der im Betrieb gewonnenen Erkenntnisse aus der Pilotanlage und der Versuchskläranlage können bspw. Vorgaben für den Nachweis der Wirksamkeit der 4. Reinigungsstufe entwickelt werden (u.a. Probenahme, Substanzauswahl, Analytik, Berechnung der Eliminationsleistung, Dokumentation). Des Weiteren können die Kläranlagenbetreiber in Schleswig-Holstein die neuen innovativen Verfahren bzw. Verfahrenskombinationen kennenlernen und den Umgang mit der Technik erlernen.
Es ist somit geplant, die VAK mit modularen Elementen unterschiedlicher Verfahrenstechniken der 4. Reinigungsstufe auszustatten. Diese einzelnen Module sollen entweder eigenständig oder in wechselnden Kombinationen betrieben werden können. Alle Module werden mit einer eigenen Steuerung ausgestattet, so dass sie im Betrieb autark sein können. Das zu reinigende Abwasser stammt von den kommunalen Kläranlagen und wird nach Behandlung dorthin wieder zurückgegeben. Es ist vorgesehen sowohl Rohabwasser als auch Klarwasser behandeln zu können. Die Module werden im By-Pass mit einem Volumenstrom von etwa 1 bis 2 m³/h betrieben. Die einzelnen Module werden so konzipiert, dass sie transportabel sind und damit auf verschiedenen kommunalen Kläranlagen im Land SH (jeweils für die Dauer einiger Monate) getestet werden können.
Folgende Module sind geplant, da diese (oder eine Kombination aus diesen) nach dem aktuellen Stand des Wissens die beste Reinigungsleistung erlauben:
- Eine MBR-Anlage (Membran-Belebungs-Reaktor) als Kompaktanlage als Alternative zu einer konventionellen Belebtschlammanlage zur vollbiologischen Behandlung. Alternativ kann die MBR-Anlage als eigenständige Ultrafiltrations-Anlage betrieben werden.
- Eine Ozonungsanlage als mögliche eigenständige oxidative Behandlungsstufe.
- GAK-Filtration (granulierte Aktivkohle) als mögliche eigenständige adsorptive Behandlungsstufe.
- Eine Anlage zur Behandlung mit Pulkveraktivkohle (PAK) einschließlich Kontaktbecken und Lamellenabscheider.
- Eine Tuchfiltration.
- Verbesserung der Ökosystemleistungen in den Reinfelder Teichen (VerTe)
Projektleitung
Projektbearbeitung
Laufzeit: 2022-2025
Förderung: Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Projektpartner:
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), Angewandte Aquatische Toxikologie – (Prof. Dr. Susanne Heise).
- Stadt Reinfeld (Holst.)
Projektbeschreibung:
Die Karpfenstadt Reinfeld liegt im Norden des Kreises Stormarn in Schleswig-Holstein. Das heutige Stadtbild Reinfelds wird geprägt von der Teichanlage, die von Zisterziensermönchen im 12. Jahrhundert angelegt wurde. Zunehmende Einträge aus dem ca. 75 km² großen Einzugsgebiet mit anthropogener Nutzung führen zu einer Verstärkung der Verlandung der nährstoffreichen Teiche und haben Defizite in der Zusammensetzung der verschiedenen Lebensgemeinschaften zur Folge. Die Schlammbelastung der Reinfelder Teiche ist in den letzten Jahren stark vorangeschritten. In diesem Projekt soll eine integrale Betrachtung und Bewertung von Maßnahmen zur Reduktion der Belastung mit Schlamm und Nährstoffen in den Reinfelder Teichen erfolgen, die die Grundlage für das Maßnahmenkonzept zur Sanierung und Restaurierung der Reinfelder Teiche und dessen Realisierung darstellen soll. Um die Biodiversität und die Ökosystemleistungen des Gewässersystems zu erhalten und zu verbessern, sind in diesem Projekt Maßnahmen zur Entschlammung der Reinfelder Teiche, die Verbesserung des ökologischen Zustands und begleitend dazu die Akzeptanzschaffung in der Bevölkerung durch partizipatorische Entscheidungsfindungsprozesse und die Schaffung des Bewusstseins für die Wichtigkeit und die Zusammenhänge zwischen Biodiversität, menschlichem Handeln und menschlichem Wohlergehen geplant.
Das Labor für Siedlungswasserwirtschaft der TH Lübeck ist insbesondere für ein Monitoring-Programm verantwortlich, mit dem die relevanten Nährstoffeinträge in die Teiche identifiziert und quantifiziert werden sollen.
- Integration von Starkregen-Resilienzen in die Siedlungsplanung (ReSiPlan )
Projektleitung
Prof. Dr.-Ing. Matthias Grottker (i.R.) Projektbearbeitung
Laufzeit: 2021-2024
Förderung: Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Förderprogramm “Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels”
Projektpartner:
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Stadtplanung (Prof. Dr. Robin Ganser)
- Stadt Ostfildern
Projektbeschreibung:
Die Notwendigkeit einer flächensparenden Siedlungsentwicklung ist gesellschaftlicher und politischer Konsens. Normativ manifestiert sich dies unter anderem als so genannte ‚Bodenschutzklausel‘ (§ 1a Abs. 2 BauGB) im Bau- und Planungsrecht. Eine bauliche Entwicklung im bestehenden Siedlungsbereich ist dabei einer Entwicklung im Außenbereich vorrangig.
Insbesondere in stark wachsenden Kommunen ist die Bereitstellung von Wohnraum, aber auch von anderen Nutzungen auf Brachflächen oder anderen verfügbaren Flächen im Innenbereich eine große Herausforderung. Ferner wird in manchen Kommunen aufgrund anhaltenden starken Siedlungsdrucks die Entwicklung neuer Stadtquartiere auch im Außenbereich erforderlich. Gleichzeitig steigen die Anforderungen insbesondere an die Infrastrukturen der Siedlungsentwässerung durch den Klimawandel, dessen Effekte sich in stark versiegelten Innenbereichen noch verstärken.
Es ist davon auszugehen, dass Starkregenereignisse zukünftig häufiger auftreten und in ihrer Intensität zunehmen. Dies bedeutet zum einen, eine notwendige Anpassung der Siedlungsentwässerungssysteme und zum anderen, eine Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Bereiche, die die Siedlungsentwässerung nicht über Kapazität belastet. Die ohnehin größeren Niederschlagsmengen addieren sich mit zusätzlichen Abflussmengen durch bauliche Verdichtung bzw. Ergänzungen im baulichen Bestand und auch bei hochverdichteten Neuplanungen. Hieraus ergibt sich die Herausforderung für die Regionalplanung und insbesondere die umsetzungsorientierte Bauleitplanung, die bauliche Entwicklung deutlich stärker mit der Siedlungsentwässerung abzustimmen, um insgesamt eine effiziente und auf Starkregen bezogen resiliente Siedlungsentwicklung zu erreichen, welche auf eine Vermeidung und Minimierung von Überflutungen durch Starkregen abzielt.
Die Stadt Ostfildern stellt sich den vorgenannten Herausforderungen. Diese sind dort besonders akzentuiert, da die Stadt unter hohem Siedlungsdruck steht, der es erfordert sowohl kleinteilige Nachverdichtungen, als auch größere Siedlungserweiterungen vorzunehmen. Aufgrund der Flächenknappheit und nach Maßgabe der vorgenannten Flächensparziele, muss die Stadt die wenigen verfügbaren Flächen durch hohe städtebauliche Dichten möglichst effizient nutzen. Dies wiederum bedeutet, dass zukünftige Starkregenereignisse in besonderer Weise berücksichtigt werden müssen. Insbesondere auf der in der Regionalplanung ausgewiesenen Stadterweiterungsfläche ‚Ruit Nordwest‘ kam es bereits zu Überflutungen bei Starkregenereignissen, die auch den bestehenden Siedlungsrand bedrohten.
Ziel dieses Vorhabens ist daher die Entwicklung einer ‚Tool Box‘ als kommunales Leuchtturmprojekt, das die Belange der Stadtplanung und Siedlungswasserwirtschaft vereint, um so eine starkregen-resiliente Siedlungsentwicklung bei der Nachverdichtung im baulichen Bestand, ebenso wie bei der Entwicklung eines neuen Stadtteils zu ermöglichen. Die zu entwickelnde ReSiPlan Tool Box beinhaltet zu diesem Zweck ein integriertes Planungs- und Analyseverfahren sowie ein fachlich-rechtlich abgestimmtes Instrumentarium, welches zukünftig als Standard für die Stadt Ostfildern etabliert werden soll. Darüber hinaus soll die Tool Box auch weiteren Kommunen mit ähnlichen Problemlagen als Vorbild dienen bzw. dort Anwendung finden.
- Etablierung einer vereinfachten Bilanzierungsmethode zur Abschätzung des Anteils von Kläranlagen-Abläufen an der Spurenstoff-Belastung in den Oberflächengewässern Schleswig-Holsteins - Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung des Einflusses von Kläranlagen auf die Gewässerqualität (SPuGe-SH)
Projektleitung
Projektbearbeitung
Laufzeit: 2021-2024
Förderung: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) des Landes Schleswig-Holstein
Projektpartner:
- Limbach Analytics/ Chemisches Laboratorium Lübeck (CLL)
Projektbeschreibung:
Kläranlagen (KA) der Größenklasse 3 bis 5 tragen in Schleswig-Holstein (SH) vermutlich erheblich zum Eintrag vieler anthropogener Spurenstoffe in Oberflächengewässer bei. Hierzu zählen neben Arzneistoffen auch Pflanzenschutzmittel, Haushalts- und Industriechemikalien, Kunststoffe sowie Kunststoffzusätze, halogenierte Kohlenwasserstoffe u.dgl.
Ein Teil dieser Substanzen wird als prioritärer Stoff in der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) in der Anlage 8 geführt. Bei diesen Stoffen wird ein signifikantes Risiko für die aquatische Umwelt erwartet. Die entsprechende EU-Richtlinie (2013/39/EU, zuvor: 2008/105/EC) definiert Umweltqualitätsnormen (UQN), die zur Beurteilung des Zustands der Gewässer nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) herangezogen werden. Bisher umfasst diese Richtlinie 2013/39/EU in erster Linie Pflanzenschutzmittel, Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetalle. Die Richtlinie wurde mit der Novellierung der OGewV im Jahr 2016 in deutsches Recht umgesetzt. Daneben werden in der OGewV in Anlage 6 UQN für flussgebietsspezifische Spurenstoffe geführt, darunter ebenfalls PAK, Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel.
Arzneistoffe werden derzeit nur auf einer Beobachtungsliste („watch list“) geführt, um aus den zu erhebenden Daten künftig UQN ableiten zu können. Bei diesen Stoffen und bei den diskutierten Stoffen, die noch nicht in der OGewV definiert sind, kann jedoch zukünftig damit gerechnet werden, dass diese in der OGewV mit einer UQN aufgenommen werden.
Aus dem F&E-Projekt „PrioSH“ ist bekannt, dass viele Spurenstoffe in Kläranlagen (KA), die dem Stand der Technik entsprechen, nicht vollständig zurückgehalten werden können, so dass ein negativer Einfluss auf die Oberflächengewässer zu befürchten ist. Somit könnte es infolge der Einleitung von gereinigtem Abwasser zu einer Überschreitung einzelner UQN in bestimmten Wasserkörpern kommen.
Im Rahmen des Projektes SpuGeSH sollen Spurenstoffkonzentrationen im KA-Ablauf sowie Ober- und Unterstrom der Einleitung ins Oberflächengewässer bestimmt werden, um den Einfluss der KA auf die Gewässerqualität bzgl. dieser Spurenstoffe beurteilen zu können. Dabei spielt die Verdünnung des KA-Ablaufes durch das Gewässer eine entscheidende Rolle. Diese soll durch die parallele messtechnische Erfassung der Abflüsse im Gewässer (und daraus abgeleiteter Frachtbestimmung) ermittelt werden. Darüber hinaus spielt neben der Größe der KA auch die Größe und Nutzung des Gewässereinzugsgebietes eine wesentliche Rolle.
Sollten KA-Einleitungen einen signifikanten Einfluss auf die Gewässerqualität haben bzw. die UQN bestimmter Parameter im Gewässer überschritten werden, wären weitergehende Maßnahmen bei der Abwasserreinigung zu erwägen. Im Rahmen des Projektes sollen für diese Abwägung Kennwerte zur Quantifizierung des Einflusses von KA auf die Gewässerqualität abgeleitet werden. Die Projektergebnisse sollen mithin die Identifikation kritischer Gewässerabschnitte hinsichtlich einer möglichen Überschreitung der UQN in den Oberflächengewässern Schleswig-Holsteins unterstützen.
Downloads:
- Phosphat Eliminierung aus dem Kläranlagenkreislauf ohne Einsatz von chemischen Fällungsmitteln (PEKEF)
- Spurenstoffe und Multiresistente Bakterien in den Entwässerungssystemen Schleswig-Holsteins Ableitung von Kennwerten zur Quantifizierung der Herkunft, der Ausbreitung und des Rückhaltes (Prio-SH)
Projektleitung
Projektbearbeitung
Laufzeit: 2017-2020
Förderung: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
Projektpartner:
- Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Arbeitsbereich Krankenhaushygiene (Prof. Dr. Johannes Knobloch)
- Limbach Analytikcs, Chemisches Laboratorium Lübeck (CLL)
Projektbeschreibung:
Das Ziel der Studie ist die Ableitung von Kennwerten, die die Prognose von Spurenstoff-Frachten im urbanen Wasserkreislauf ermöglichen. Hierzu zählen insbesondere spezifische Zu- und Ablauffrachten kommunaler Kläranlagen. Darüber hinaus wird die Belastung des Rohabwassers sowie die spezifische Eliminationsleistung einzelner Verfahrensstufen bestimmt. Berücksichtigung finden Kläranlagen, wie sie derzeit typisch für Schleswig-Holstein sind. Diese Kläranlagen sind dem Stand der Technik entsprechend für eine Nährstoffelimination (C, N, P) mit einer Belebungsstufe und ggf. weitergehender biologischer oder physikalischer Stufen (z. B. Tropfkörper, Filtration) ausgestattet. Nicht untersucht wurden Verfahrensstufen, die als sog. Vierte Reinigungsstufe (z. B. Ozonung, Aktivkohlefiltration) dem gezielten Rückhalt von Spurenstoffen dienen. Die Untersuchung ergänzt zahlreiche vorherige deutsche und internationale Studien um eine schleswig-holsteinische Perspektive. Insgesamt werden 50 Spurenstoffe berücksichtigt, die aus verschiedene Quellen stammen (Schwermetalle, Arzneistoffe, Pflanzenschutzmittel, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe [PAK] sowie weitere Industrie- und Haushaltschemikalien). Die in dieser Studie berücksichtigten Stoffe orientieren sich an zuvor in Schleswig-Holstein in Kläranlagenabläufen und in Oberflächengewässern nachgewiesenen Substanzen.
Die Studie berücksichtigt hierbei gemeinsam das Vorkommen von Spurenstoffen und multiresistenten Keimen in einem integrierten Messprogramm. Die Abwasserproben wurden quantitativ auf 3. Generations Cephalosporin resistente E. coli (3GCREC) als Markerorganismus untersucht. Repräsentative Isolate der isolierten 3GCREC wurden mittels Gesamtgenomsequenzierung weitergehend charakterisiert. Diese Methode erlaubt auch die Identifikation von 4-fach multiresistenten Gram-negativen Erregern (4MRGN), die auch resistent gegenüber den als Reserveantibiotika geltenden Carbapenemen sind. Insbesondere als 4MRGN klassifizierte Erreger stellen eine besondere Herausforderung in der Medizin dar.
Anhand von zwei separaten Messkampagnen wurden unterschiedliche Aspekte in den Fokus genommen. In einem Intensiv-Messprogramm wurden im Besonderen einzelne Verfahrensstufen sowie deren Eliminationsleistung untersucht. Dieses Messprogramm dient zur verfahrensspezifischen Beurteilung des Spurenstoffrückhalts und für eine Massenbilanzierung, die die Identifikation relevanter Senken erlaubt. In einem anschließenden Routine-Messprogramm wurde auf Basis monatlicher 7-Tages-Mischproben des Rohabwassers und des Kläranlagenablaufs die saisonale Varianz der Zulauffracht und der Eliminationsleistung untersucht.
Hinsichtlich des Rückhaltes von Spurenstoffen erweisen sich in den untersuchten Kläranlagen der biologische Abbau und die Sorption als relevante Mechanismen. Weitere abiotische Prozesse (Hydrolyse, Photolyse) oder Strippung kommen bei diesen Verfahren nur im Einzelfall zum Tragen und sind meist nicht relevant. Anhand bekannter Stoffkennwerte (Sorptionskoeffizient kd und Biodegradationskonstante kbio) können Spurenstoffe in Gruppen eingeteilt werden. Diese Stoffgruppen fassen Einzelstoffe mit ähnlichen Eigenschaften bezüglich der vorgenannten Mechanismen zusammen. Sie erlauben somit bei Kenntnis der Stoffeigenschaften auch die Prognose des Verhaltens von Stoffen, die nicht in dieser Studie berücksichtigt wurden.
Die Ergebnisse zeigen, dass gut biologisch abbaubare Stoffe (z. B. einige Arzneistoffe) und sorptionsaffine Stoffe (v. A. Schwermetalle und PAK) in der mechanisch-biologischen Abwasserreinigung gut zurückgehalten werden können. Als relevante Verfahrensstufe ist hierbei die Belebungsstufe anzusehen, in der einerseits der größte Anteil des biologischen Abbaus stattfindet. Für sorptionsaffine Stoffe stellt der aus der Nachklärung abgezogene Überschussschlamm die relevante Senke dar. Diese Stoffe akkumulieren sich nach der Schlammbehandlung im Klärschlamm. Im Rahmen üblicher und in der Praxis umsetzbarer Betriebsparameter (Schlammalter, Schlammbelastung, Trockensubstanzgehalt) kann nur ein marginal verbesserter Spurenstoffrückhalt in der Belebungsstufe erfolgen.
Stoffe, die nicht sorptionsaffin sind und die nicht oder nur mäßig biologisch abbaubar sind, werden nicht oder nicht vollständig in der konventionellen biologischen Abwasserreinigung zurückgehalten. Zu diesen Stoffgruppen zählen aufgrund der erforderlichen Stoffeigenschaften u. a. viele Arzneistoffe und Pflanzenschutzmittel. Zudem ist zu vermuten, dass weitere als Industrie- oder Haushaltschemikalien eingesetzte Substanzen nicht vollständig zurückgehalten werden.
Es zeigt sich, dass bei der konventionellen mechanisch-biologischen Abwasserreinigung eine deutliche Reduzierung der multiresistenten Keime im Wasserpfad (2,46 bis 4,31 log-Stufen) erfolgt. Dieses ist in erster Linie auf den Rückhalt suspendierter Stoffe v. A. in der Nachklärung zurückzuführen, da die Keime i. d. R. feststoffgebunden sind. Dennoch verbleiben im Kläranlagenablauf im Mittel rund 103 3GCREC Erreger pro Liter. Durch eine UV-Desinfektion lässt sich die Anzahl deutlich reduzieren. Als relevante Senke für Keime ist hingegen der Klärschlamm anzusprechen, der im Rahmen dieser Studie nicht auf das Vorhandensein von multiresistenten Keimen untersucht werden konnte.
Vorliegende Studie umfasst nicht die Beurteilung einer ökotoxikologischen Bewertung bezüglich der in die Gewässer eingetragenen Stofffrachten. Kommt eine entsprechende Betrachtung zu dem Ergebnis, dass einzelne Stoffe der nicht vollständig zurückgehaltenen Stoffgruppen ein ökotoxikologisches Risiko darstellen, ist zwangsläufig die Implementierung einer weiteren Verfahrensstufe erforderlich. Die Betrachtung dieser sog. Vierten Reinigungsstufe ist ebenfalls nicht Gegenstand dieser Studie.
In einer zweiten Projektphase wurde insbesondere der biologische Abbau und die Sorption der betrachteten Spurenstoffe detailliert auf der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) untersucht.
Für den Rückhalt anthropogener Spurenstoffe in der kommunalen Abwasserreinigung stellen die Sorption am Belebtschlamm sowie der biologische Abbau die dominierenden Mechanismen dar. Beide Prozesse lassen sich durch Modelle beschreiben. Zur Ermittlung der Eliminationsraten müssen die Biodegradationskonstante kbio sowie der Sorptionskoeffizient kd bekannt sein. Während des Betriebs von kommunalen Kläranlagen können beide Parameter nur abgeschätzt werden, da in der Regel die Stoffwechselvorgänge in der Belebung durch Kreislaufströme (z. B. Trübwasser aus der Schlammbehandlung) beeinflusst wird. Daher werden die genannten Parameter daher häufig im Standversuch (Batch-Versuch) ermittelt. Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den realen Kläranlagenbetrieb ist allerdings aufgrund der fehlenden kontinuierlichen Beschickung fraglich.
Vorliegende Studie greift diese Problematik auf und erweitert vorhandene Modelle zur statischen Bestimmung der genannten Kenngrößen, um in Durchlaufreaktoren dynamische Parameter zu bestimmen. Diese berücksichtigen insbesondere im Vergleich zu statischen Batch-Versuchen variierende Stofffrachten im Zulaufstrom und geben daher besser die dynamischen Vorgänge während der biologischen Behandlung von kommunalen Abwasser wieder, dessen Vorkommen gerade bei kleinen Gemeinden eine sehr deutliche tageszeitliche sowohl quantitative als auch qualitative Variation aufweist.
Der Einsatz von Metallsalzen erfolgt primär für die Fällung von Phosphat, welches kaum mittels ausschließlich biologischer Verfahren ausreichend aus dem Abwasser entfernt werden kann. Parallel werden Spurenstoffe infolge der durch die Gabe der Metallsalze erfolgenden Prozesse zurückgehalten. Die Studie geht auf die relevanten Mechanismen ein und beantwortet die Frage, welche Arten von Spurenstoffen gezielt durch diese Verfahren aus dem Wasserpfad eliminiert werden könnten. Schließlich erfolgt die Untersuchung des Einflusses der Gabe von üblichen Co-Substraten auf die Nachweisbarkeit von Spurenstoffe.